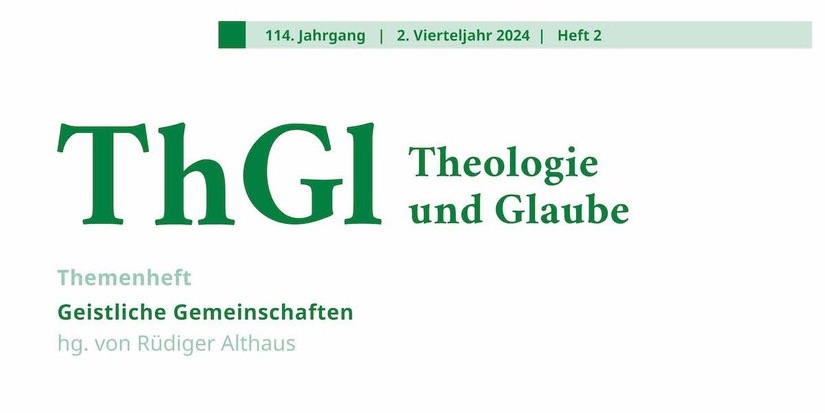Ein Gerechter, ein Gefangener

Bernhard Lichtenberg auf einem undatierten Bild. Foto: KNA
von Claudia Auffenberg
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, heißt es im Evangelium des heutigen Sonntags. Da wir im Lesejahr B sind, wird die Version des Evangelisten Markus verkündet. Der Evangelist Lukas hat diesen kleinen Disput zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten um ein berühmtes Gleichnis ergänzt, das um die Frage kreist: Wer genau ist mein Nächster? Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und macht klar: Der Nächste ist der, dessen Notlage ich wahrnehme. Punkt. Weitere Kriterien wie Staats- oder Religionszugehörigkeit gibt es nicht. Doch trotz dieser Antwort Jesu ist die Frage im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gestellt und seine Antwort relativiert worden. Auch jetzt gerade scheint für manche, die sich Christen nennen oder Kreuze aufhängen, das Argument, dass der Flüchtling, der im Mittelmeer zu ertrinken droht, mein Nächster sein könnte, nicht mehr zu ziehen. Kann denn ein Moslem mein Nächster sein?
Vor rund 80 Jahren hieß diese Frage: Kann ein Jude mein Nächster sein? Einer, der das klar bejaht hat – und damit in der Minderheit war – war der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg. Am 5. November gedenkt die Kirche dieses Seligen. Geboren wurde er am 3. Dezember 1875 in Ohlau, Niederschlesien. Er starb am 5. November 1943 im bayerischen Hof auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau.
Lichtenberg war immer auch ein politischer Priester und auf kommunaler Ebene Abgeordneter der Zentrumspartei. Das brachte ihn noch vor der sogenannten Machtergreifung ins Visier Joseph Goebbels; auch sein Engagement für die Juden, das er ab 1933 verstärkte. 1937 wurde er Dompfarrer an der Hedwig-Kathedrale in Berlin, ein Jahr später übernahm er die Leitung des „Hilfswerkes beim Bischöflichen Ordinariat Berlin“, das vielen Katholiken jüdischer Abstammung half, unterzutauchen und Deutschland rechtzeitig zu verlassen.
Als am 9. November die Synagogen brannten, erklärte Lichtenberg öffentlich: „Draußen brennt der Tempel. Das ist auch ein Gotteshaus!“ Von da an betete er täglich für die Juden, für die „nichtarischen“ Christen und alle anderen Opfer des Regimes.
Das Engagement für die Juden begründete Lichtenberg mehrfach öffentlich mit dem Wort Jesu: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Er erkenne auch „im Juden meinen Nächsten, der eine unsterbliche, nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffene Seele besitzt“.
Wegen Heimtücke und Kanzelmissbrauch wurde er 1942 zu zwei Jahren Haft verurteilt, die er in Berlin-Tegel absaß. Damals war er schon schwer krank. Unmittelbar nach seiner Entlassung wurde er erneut verhaftet und sollte ins KZ Dachau gebracht werden. Auf dem Weg dorthin starb er.
Am 23. Juni 1996 sprach Papst Johannes Paul II. ihn bei seinem Deutschlandbesuch selig, am 7. Juli erkannte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ihn als „Gerechten unter den Völkern“ an. Er selbst nannte sich „Gefangener im Herrn“, so hatte er seinen letzten Brief aus Berlin-Tegel unterschrieben.