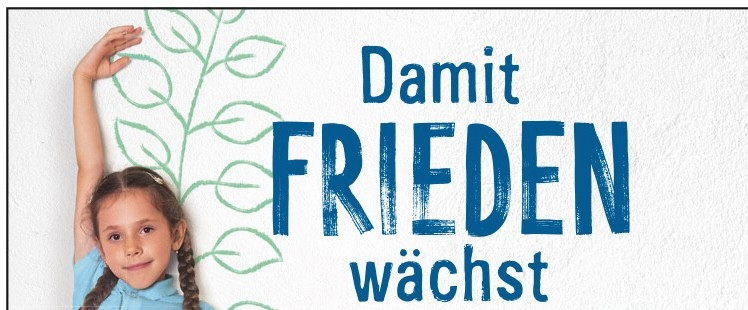Gib Frieden in unseren Tagen

Fotos: Foto: kallejipp – photocase / Theolgogische Fakultät Paderborn
Mit der „Versuchungsbitte“ endet der biblische Text des Vaterunsers, nicht aber der in der Liturgie verwendete. Häufig kommt an dieser Stelle ein Einschub, der sogenannte Embolismus. Wir sprachen darüber mit Stefan Kopp (kl. Foto), Professor für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Paderborn.
von Claudia Auffenberg
Herr Prof. Kopp, woher kommt der Einschub?
Papst Gregor der Große (590–604) ließ den Embolismus in die römische Liturgie einfügen, als die Lombarden vor den Toren Roms standen. Er wusste aus mailändischen und anderen Berichten, wie es bei der Eroberung einer Stadt durch heidnische Kriegshorden zu besinnungsloser, panischer Angst in der christlichen Bevölkerung kommen konnte, sodass das „Rette sich, wer kann!“ bei vielen alles Denken an Gebet und Übung der Nächstenliebe zurückdrängte. Unmittelbar nach dem Herrengebet und zusammengenommen mit den Worten „gib Frieden in unseren Tagen“ meinen die Worte „bewahre uns vor Verwirrung und Sünde“ nichts anderes als: Bewahre uns vor einem Kriegsgeschehen, das uns unfähig machen könnte, das Vaterunser noch zu beten oder das Hauptgebot zu üben.
Dieser Einschub hat seine Parallelen auch in nichtrömischen Liturgien des Westens und des Ostens mit Ausnahme des byzantinischen Ritus, wo auf das Vaterunser nur die altkirchliche Doxologie, also der feierliche Lobpreis zum Abschluss, folgt.
Welchen Sinn hat der Einschub? Er wiederholt doch im Grunde die vorhergehende Bitte, mit der wir uns ja gerade herumplagen.
In der Tat unterstreicht der Embolismus die Bedeutung, die den letzten Bitten des Herrengebetes zugesprochen wird.
Warum betet der Priester ihn nicht immer?
Vielleicht wird die doppelte Bitte um Erlösung von dem Bösen und der Akzent auf die Bewahrung vor der Sünde von manchen als zu dominant empfunden. Oder man möchte die Liturgie einfach etwas verkürzen und meint, dies hier besonders gut tun zu können.
Könnte das Weglassen ein ökumenisches Anliegen sein? Die evangelischen Christen kennen diesen Einschub ja nicht.
Gerade aus ökumenischerPerspektive fände ich eine Streichung des Embolismus problematisch. Die Doxologie, die in einigen altkirchlichen Handschriften bereits dem neutestamentlichen Text hinzugefügt wurde und in der evangelischen Tradition zum integrierenden Element des Vaterunsers geworden ist, beten auch wir Katholiken außerhalb der Liturgie heute immer mit, was früher innerhalb der Messfeier in unserer Tradition nie üblich war.
Ich würde vor dem Hintergrund der historischen Entwicklungen also insgesamt meinen: In der heutigen liturgischen Komposition von Vaterunser, Embolismus und Doxologie verbinden sich westliche und östliche Gebetstraditionen, die die ökumenische Fülle des Gebetsschatzes der ganzen Kirche repräsentieren und daher gepflegt oder neu entdeckt werden sollten.